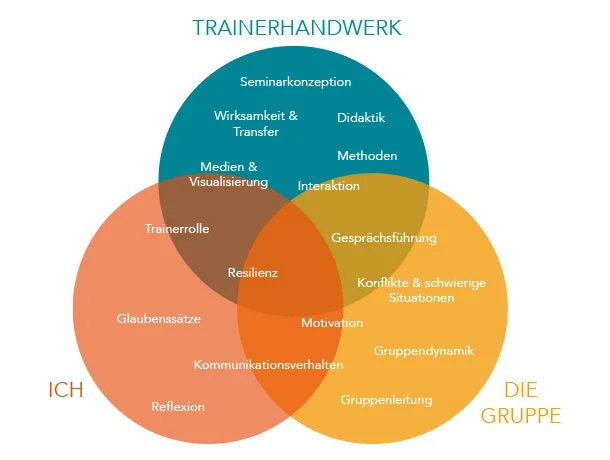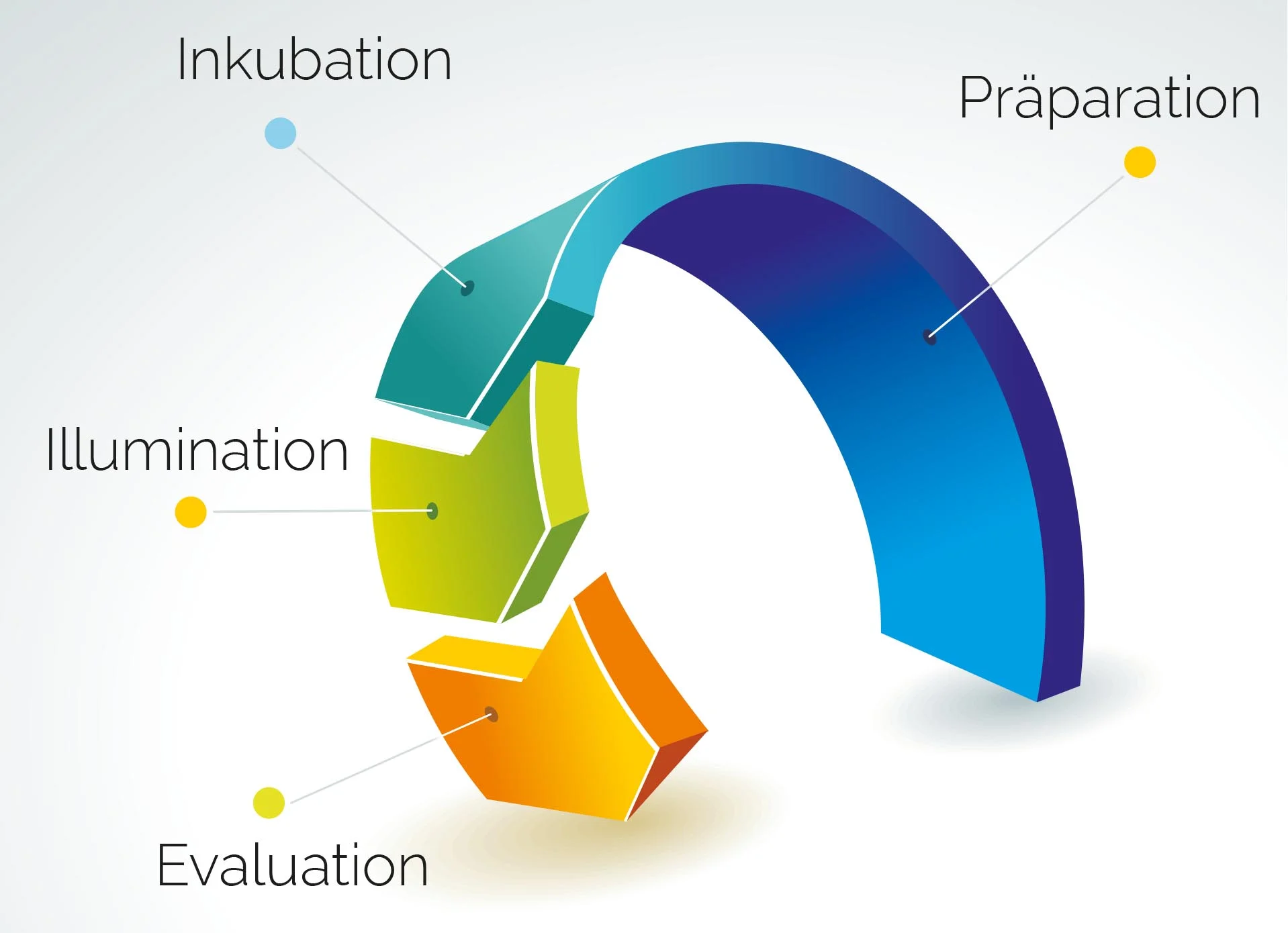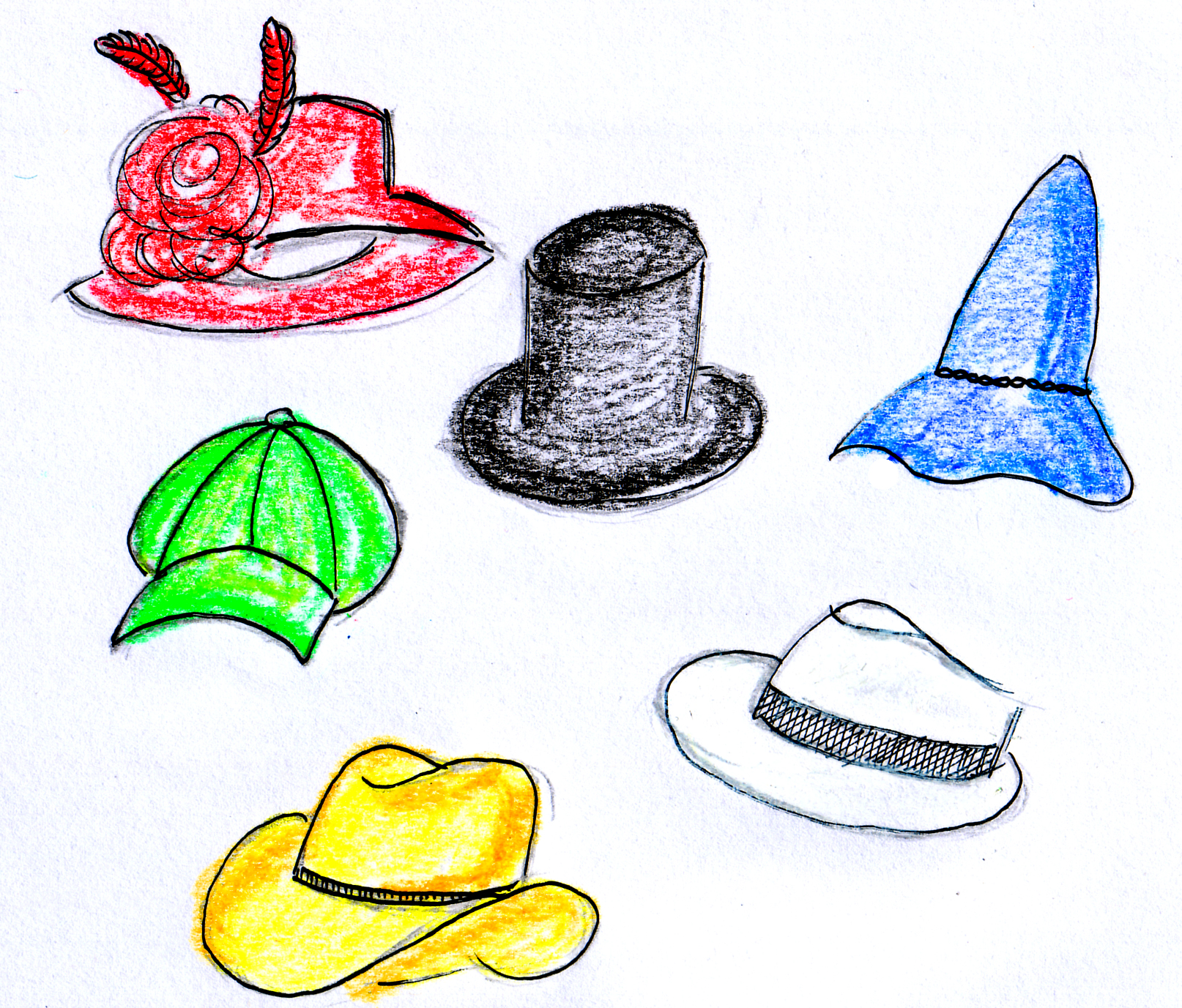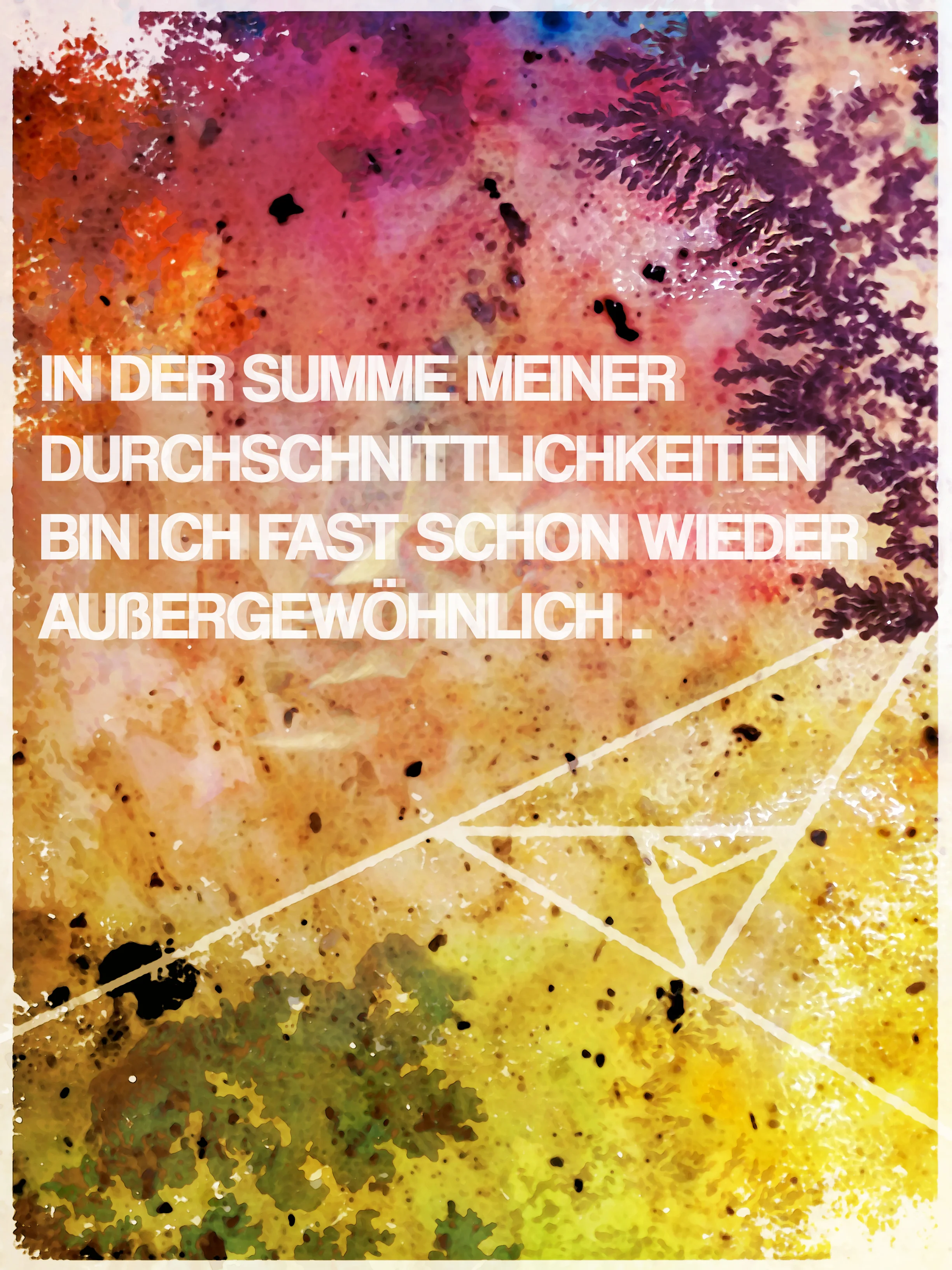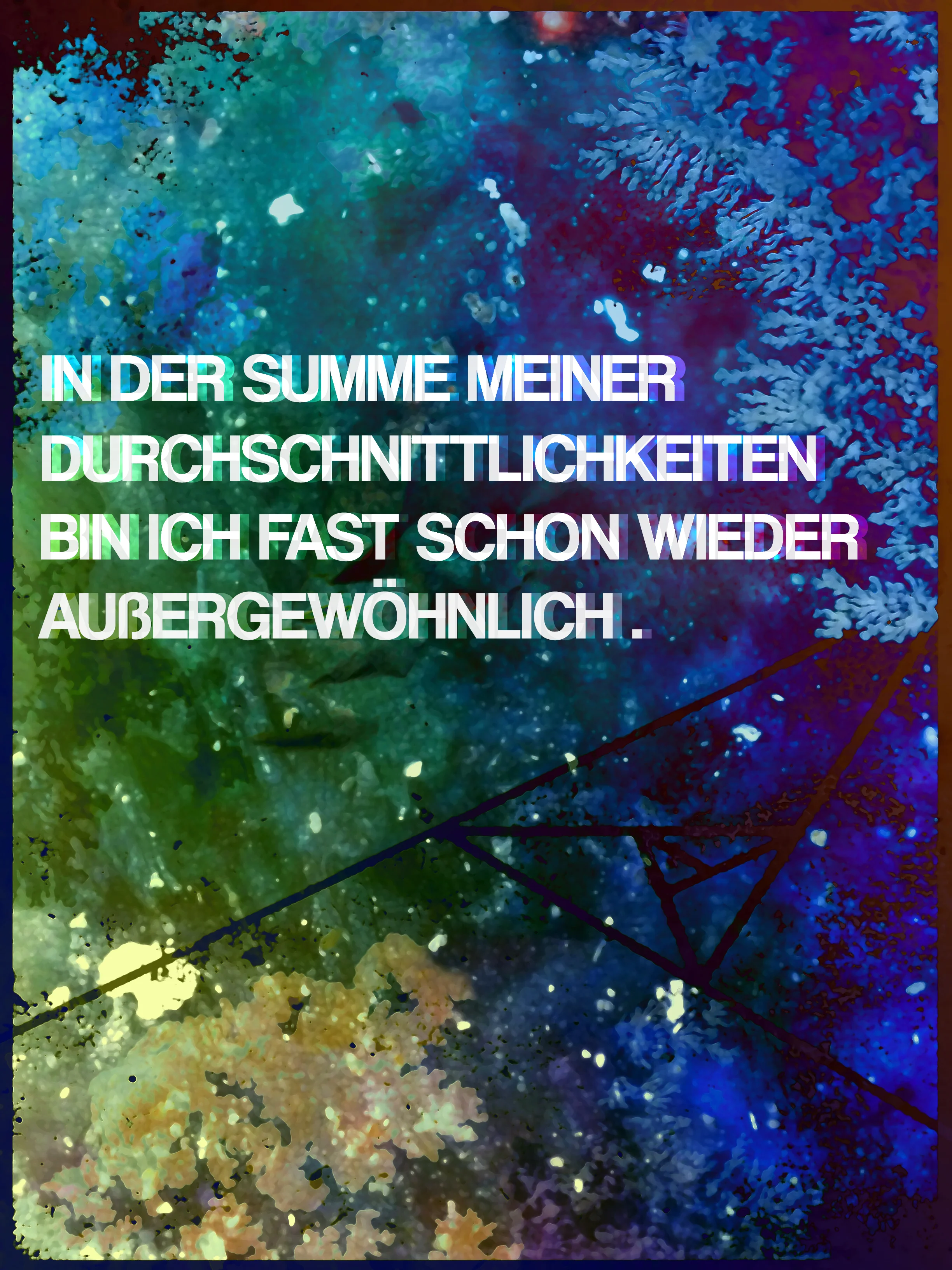Zu Beginn diesen Jahres hat ein neuer Coachee ein Stimmtraining bei mir aufgenommen. Er hat die erste Coachingstunde von seiner Partnerin geschenkt bekommen, nachdem er diesen Wunsch schon längere Zeit mit sich herum getragen hat. Sie hat mich über Empfehlungen ausfindig gemacht.
Nachdem die erste Sitzung vorbei war, er seine Sachen zusammengepackt hatte und in der Tür stand, meinte er, dass er nun sehr froh sei. Er hatte zuvor schon immer und immer wieder gesucht, aber wusste nicht wirklich an wen er sich wenden könne und solle. So groß undunübersichtlich sei das Angebot, vor allem wenn man sich im Internet schlau macht.
Geht es Ihnen so ähnlich? Suchen Sie professionelle Unterstützung zum Thema Stimme? Wer schon mal nach einem Trainer oder Therapeuten gesucht hat, weiß wie groß und unübersichtlich das Angebot ist. Deshalb ist es gut einige Orientierungspunkte zu haben, um schließlich bei der richtigen Adresse zu landen. Denn mit dem Thema Stimme beschäftigen sich unterschiedliche Disziplinen und Personen. Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Disziplinen:
Phoniatrie & HNO-Heilkunde
Hierbei handelt es sich um zwei medizinische Fachgebiete, die sich mit Erkrankungen der Stimme und Sprechens beschäftigen. Die Phoniatrie ist das Fachgebiet für Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen, sowie kindliche Hörstörungen. Der Phoniater ist also der Arzt, den Sie als erstes ansprechen können, wenn es um Stimmprobleme geht. Machen Sie ein Termin aus, wenn Sie wiederkehrend Probleme, wie z.B. Heiserkeit oder Sprechanstrengung verspüren.
Logopädie & Sprachtherapie
Hierbei handelt es sich um die therapeutische Fachdisziplin, die sich mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen auseinandersetzt. Um eine Therapie aufzunehmen, brauchen Sie ein Rezept vom HNO-Arzt bzw. Phoniater. Achten Sie darauf, einen Therapeuten zu finden, der sich auf die Behandlung von Stimmstörungen spezialisiert hat. Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen sicherlich empfehlenswerte Praxen in Ihrer Nähe nennen.
Sprecherziehung
Das Fachgebiet der Sprecherzieher ist das der mündlichen Kommunikation. Hierunter fallen Teilaspekte wie Rederhetorik, Gesprächsrhetorik, Argumentation, Sprechkunst, Atem- und Sprechtechnik. Sie können ein privates Training bei einem Sprecherzieher aufnehmen. Einige Sprecherzieher haben ebenfalls eine Krankenkassenzulassung, so dass Sie mit einer Überweisung des Arztes behandelt werden können. Adressen finden sie bei der Gesellschaft für Sprechwissenschaft und Sprecherziehung (DGSS).
Gesang und Schauspiel
Hierbei wird die Stimme vor allem unter künstlerischen Aspekten betrachtet. Dementsprechend ist das Feld sehr heterogen. Wer Lust hat zu singen, sollte sich zunächst über die Stilrichtung klar werden: Klassischer Gesang? Jazz-Rock-Pop? Musical? Wenden Sie sich Bei Fragen zunächst an Ihre örtliche Musikschule oder an den Bund Deutscher Gesangspädagogen (BDG), um Adressen von Gesangslehrern zu bekommen. Auch bei Laientheater- oder Improtheatergruppen kann man sich und seine Stimme erproben. Schauen Sie doch mal, welche Bühnen es in Ihrer Nähe gibt.
Was dieser Artikel hilfreich und nützlich für Sie?
Hier können Sie meinen Blog abonnieren um auf dem Laufenden zu bleiben.
https://www.julia-training.com/stimmtraining